Erweiterung der Krebsdiagnostik durch Analyse von Lymphknoten
Klinischer Einsatz und Validierung eines Multikrebs-Deep-Learning-Algorithmus zur Erkennung von Lymphknotenmetastasen auf der Basis von Foundation-Models

Diese Studie basiert auf einer engen Verbindung zwischen Informatik und klinischer Anwendung. Die Entdeckung von Krebszellen in den Lymphknoten eines Patienten ist für die Behandlung der Erkrankung von entscheidender Bedeutung. Die Analyse des Lymphknotenstatus erfordert die Fachkenntnisse eines Pathologen, ist jedoch arbeitsintensiv und mit grossem Zeitaufwand verbunden. Um Pathologen bei dieser Aufgabe zu unterstützen, wurde ein computergestütztes Diagnose-Tool entwickelt, das Deep Learning zur Erkennung von Lymphknotenmetastasen im Darmbereich nutzt. Nun werden die Wissenschafter das Training dieses Algorithmus auf Lymphknoten von zehn weiteren Krebsarten ausweiten, um dessen Nutzen für die tägliche Anwendung in der klinischen Onkologie zu erhöhen.
Was uns die Bildgebung des Knochenmarks über Leukämie verraten kann
Deepmarrow: Untersuchung der Knochenmarkumgestaltung nach intensiver Chemotherapie als Prädiktor für das Ansprechen bei akuter myeloischer Leukämie
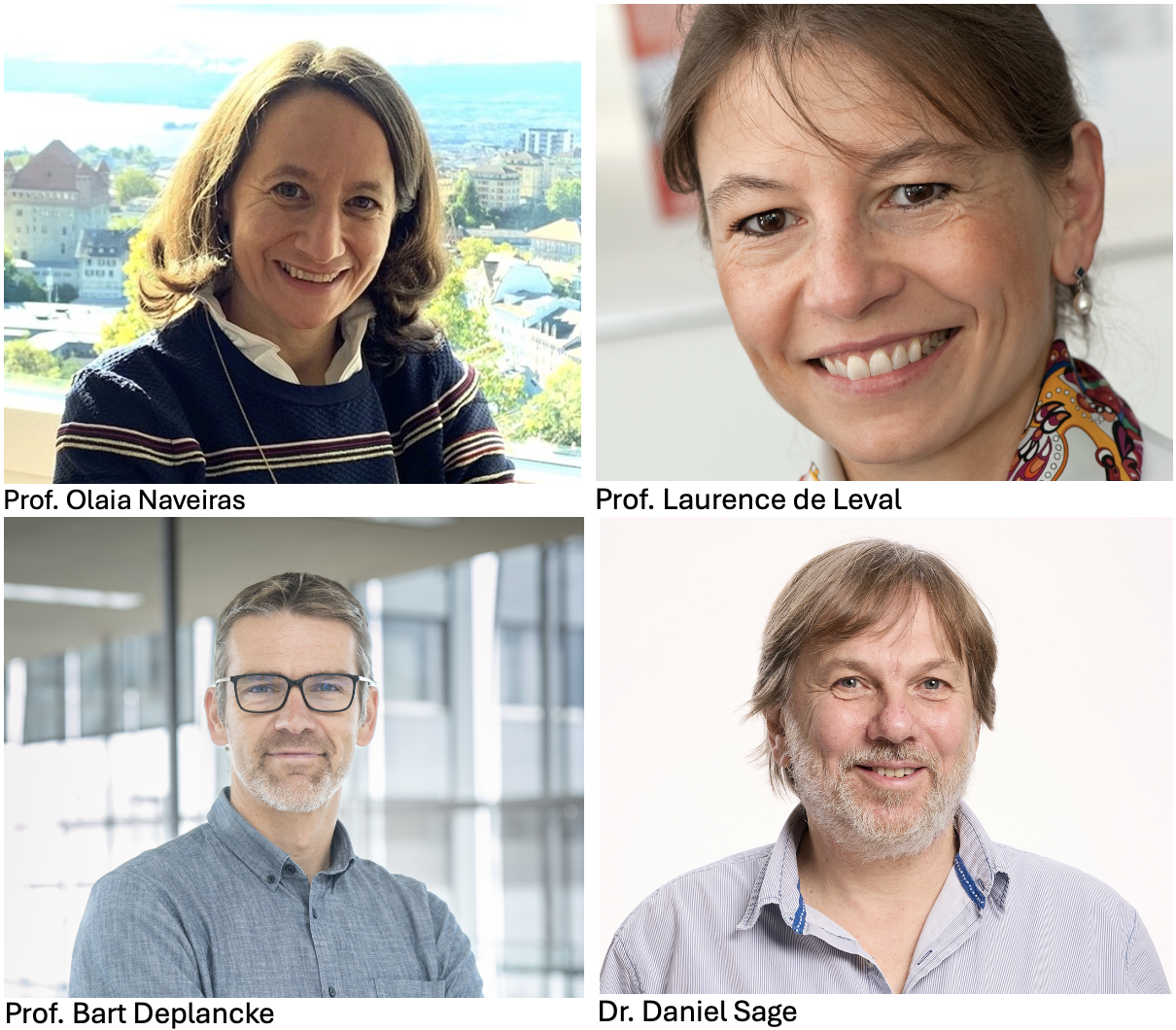
Im Verlauf der akuten myeloischen Leukämie (AML) können Veränderungen im tumorumgebenden Gewebe, dem sogenannten Stroma, dazu führen, dass Bereiche mit rascher Blutkörperchenproduktion in Zonen mit pathologischem Zellwachstum umgewandelt werden. Dies kann eine weitere Ausprägung der Erkrankung zur Folge haben. Ziel der Studie ist die Entwicklung neuer digitaler Machine-Learning-Tools auf der Grundlage der Hämatopathologie, mit denen Bestandteile des Bindegewebes im Knochenmark quantifiziert werden können. Dieses Tool könnte auch dabei helfen, AML-Patienten mit einem hohen Rückfallrisiko zu identifizieren und sollte dazu beitragen, Rückfälle bei AML vorherzusagen und zu verhindern. Dies stellt derzeit eindeutig einen ungedeckten klinischen Bedarf dar.
Diagnostik eines seltenen Lymphoms durch integrative KI
Verbesserung der Diagnostik bei nodalen Marginalzonenlymphomen durch die Integration von digitaler Pathologie, Molekularbiologie und künstlicher Intelligenz
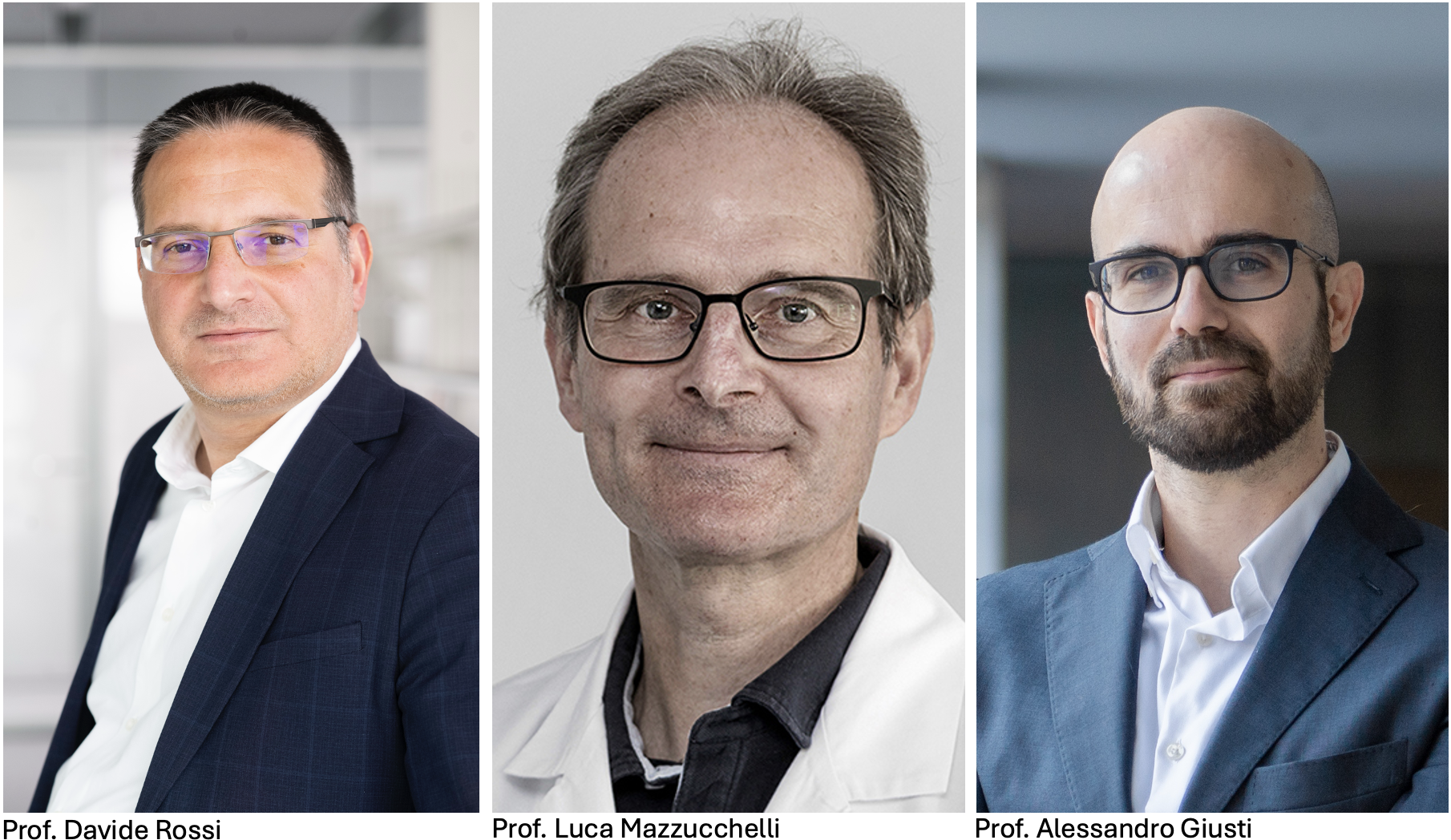
Das nodale Marginalzonenlymphom (NMZL) ist eine seltene und schwer diagnostizierbare B-Zell-Erkrankung, die oft falsch diagnostiziert wird. Die Forscher schlagen einen digitalen Pathologieansatz vor, der hoffentlich erfahrene Pathologen bei der korrekten Diagnose des NMZL übertreffen wird. Dazu werden sie Deep Learning einsetzen. Bildgebungsdaten, klinische und molekulare Daten werden integriert und ein Klassifikator erstellt, in welchen Ärzte ihre gesamten Objektträger-Scans hochladen können, um eine korrekte NMZL-Diagnose zu erhalten. Das Team hofft, mithilfe von 900 NMZL-Fällen und den dazugehörigen Proben und Daten aus ganz Europa eine klinisch anwendbare und dennoch technisch ausgefeilte Methode zur Identifizierung dieses seltenen Lymphom-Subtyps zur Verfügung stellen zu können.
Räumliche Biologie für die Risikostratifizierung des Darmkrebses
Stratifizierung des Darmkrebsrisikos mittels Bildgebung und Transkriptionsprofilen

Ziel ist es, prognostische Biomarker für Darmkrebs im Stadium II zu identifizieren. Dazu werden die Forscher computergestützte Ansätze nutzen, um fortgeschrittene molekulare Omics-Daten mit histologischen Bildern von 1800 früheren Darmkrebspatienten zu kombinieren. Es sollen prognostische Marker in Netzwerken identifiziert und anschliessend in neuen Patientenkohorten validiert werden. Dabei handelt es sich um ein fortgeschrittenes Projekt im Bereich der digitalen Pathologie.
Löst Gewebefibrose ein Wiederauftreten von Hirntumoren aus?
Räumliche Analyse und funktionelle Untersuchung fibrotischer Vernarbungsnischen bei Glioblastomrezidiven
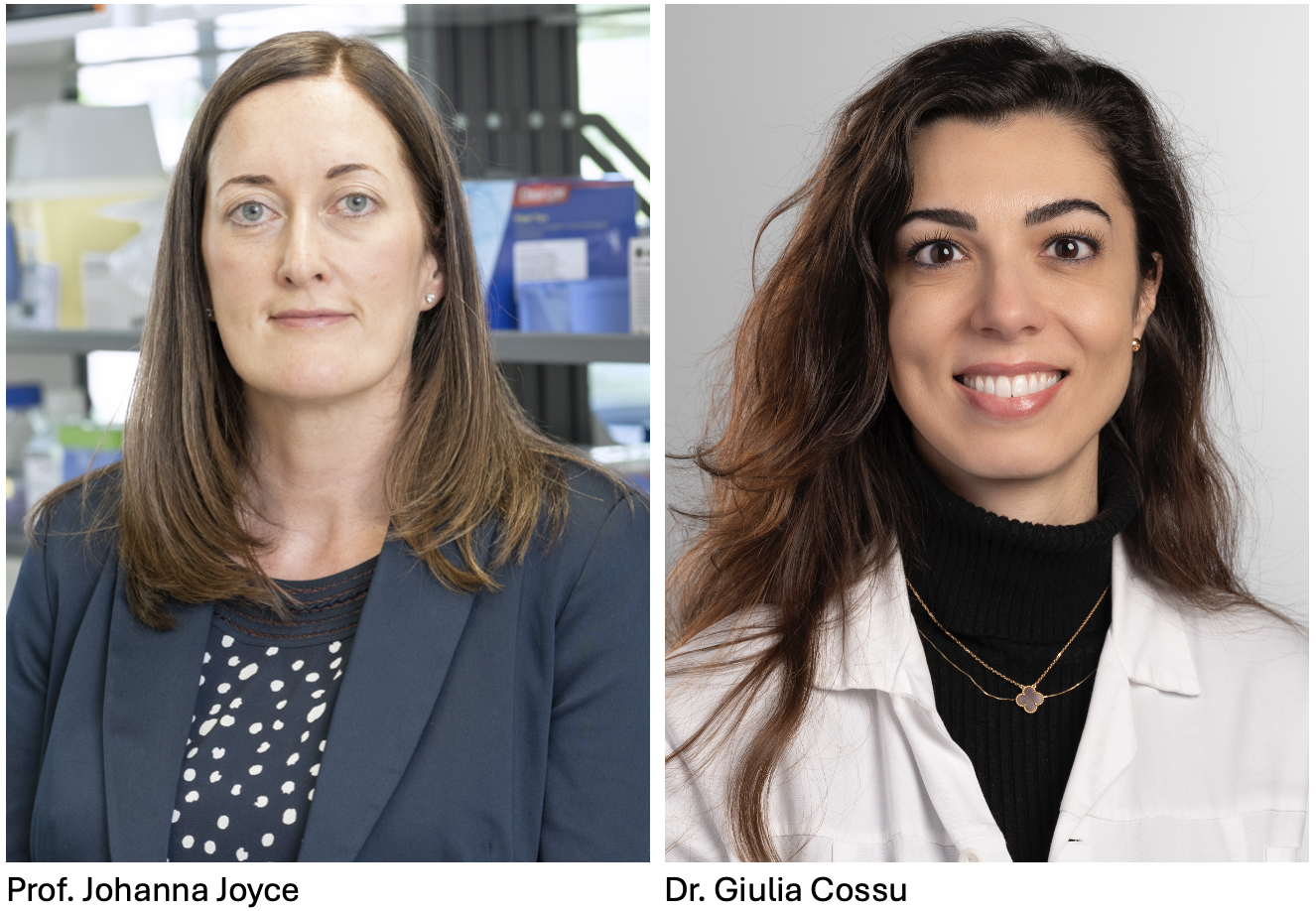
Fibrotische Vernarbungsbereiche werden mit einem Wiederauftreten von aggressiven Hirntumoren in Verbindung gebracht. In dieser Studie werden hochmoderne räumliche Multi-Omics-Technologien mit digitalen Pathologieanalysen kombiniert, um Mechanismen zu untersuchen, die bei Glioblastom-Patienten zu Fibrosen führen. Ziel der Wissenschafter ist es, neue therapeutische Angriffspunkte zu identifizieren, die die tumorschützende fibrotische Nische zerstören und so das Wiederauftreten der Krankheit verhindern können.
Differenzieren zwischen Primärtumoren und Metastasen in der Lunge mittels KI
Multiple Lungentumorknoten: Entwicklung von kostengünstigen molekularen und digitalen Pathologiemethoden zur Differenzierung zwischen multiplem primärem Lungenkrebs und intrapulmonalen Metastasen
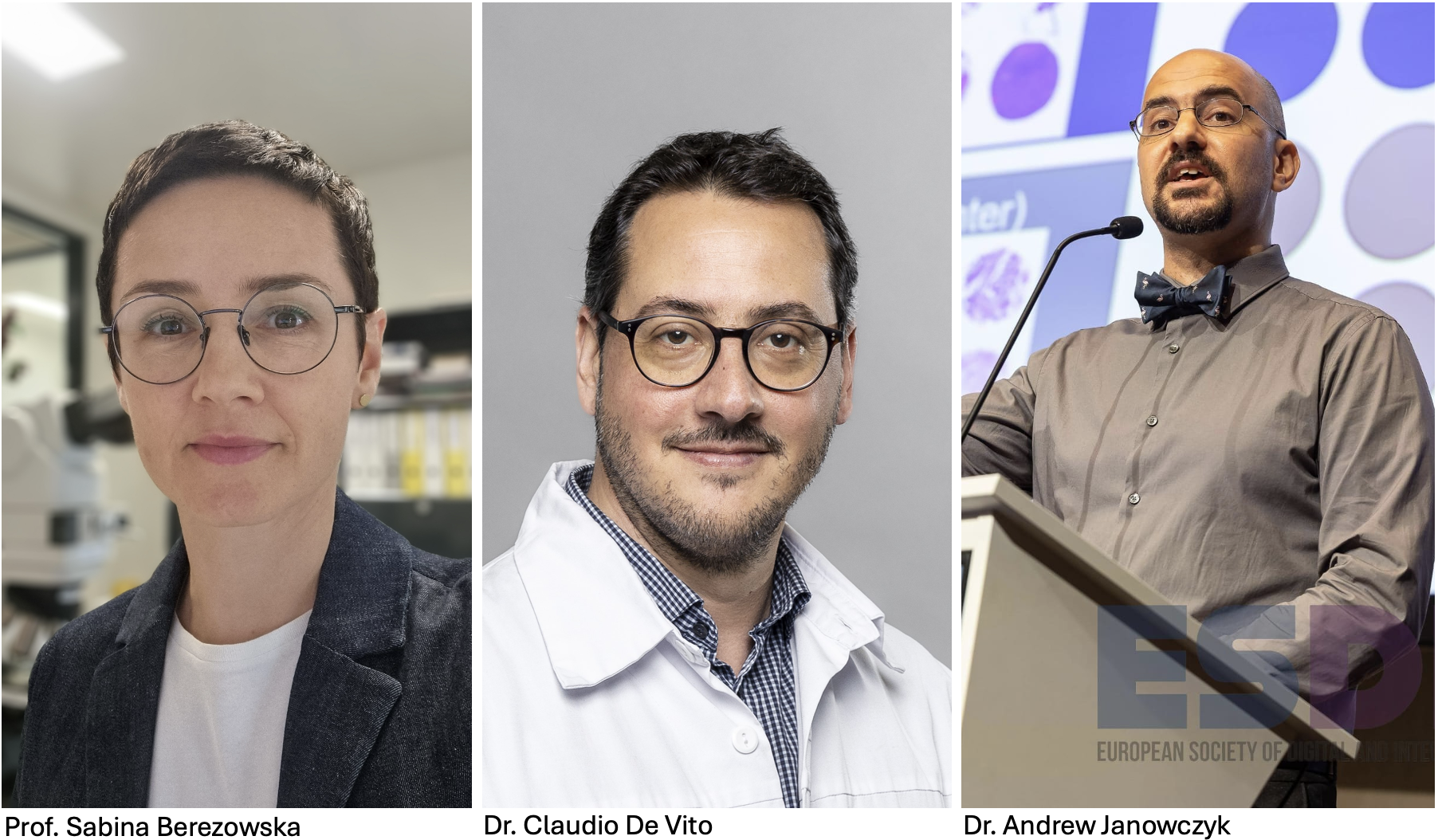
Die Analyse gefärbter Tumorbiopsien unter dem Mikroskop ist das Handwerk des Pathologen. Nun können solche Untersuchungen durch computergestützte Analysen und die Einbeziehung weiterer Informationen verbessert und ergänzt werden.
Das Team wird Gewebeschnitte von primärem Lungenadenokarzinom aus einer grossen Datenbank verwenden und diese mit metastatischen Lungenknoten, die von anderen Primärtumoren stammen, vergleichen. Das Ziel besteht darin, ein neues digitales Pathologie-Tool (DPLAS) zu optimieren, mit dem Lungenkrebserkrankungen stratifiziert und die Patienten-Triage vorgenommen werden kann. Ein Vorteil dieses Projektes ist, dass diese Technologie auf routinemässig verfügbaren H&E-Gewebeschnitten basiert, was eine breite Anwendung des Tools ermöglicht.
Optimierte Vorhersage der Immunkompatibilität zwischen Spendern und Patienten für die Transplantation hämatopoetischer Stammzellen
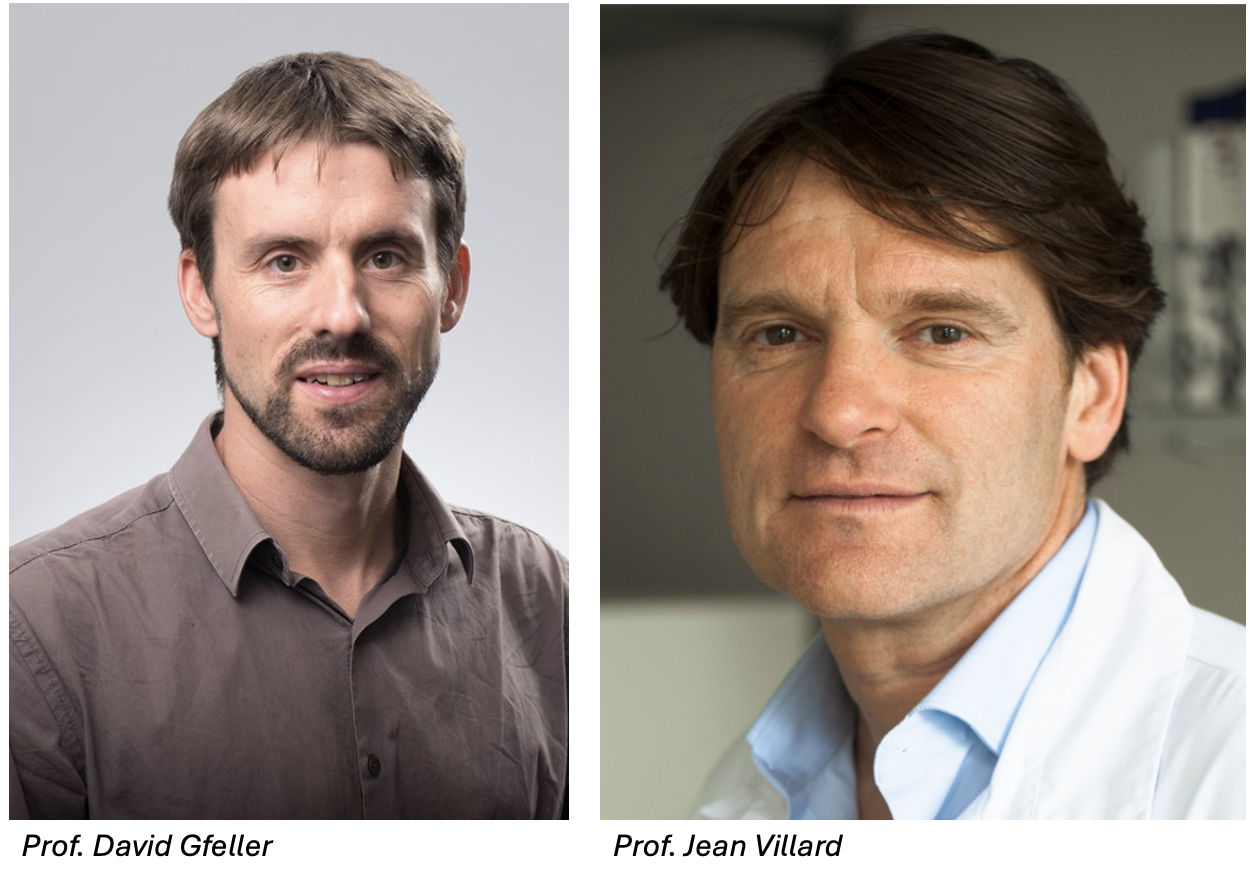
Das Hauptziel dieses Projektes ist die Optimierung der genetischen Kompatibilität zwischen Spender und Empfänger für die hämatopoetische Stammzelltransplantation (HSZT) zur Behandlung bösartiger hämatologischer Erkrankungen. Die Kompatibilität zwischen Spender und Empfänger ist einer der besten Prädiktoren für den Erfolg einer HSZT. Mit diesem Projekt soll die Präzision der Vorhersage verbessert werden, um die Inzidenz von Graft-versus-Host (Transplantat-gegen-Wirt) Reaktionen und anderen immunbedingten Komplikationen zu reduzieren. Dieser Schritt könnte die Überlebensrate und die Lebensqualität von Patienten, die sich dieser weit verbreiteten und wichtigen Behandlung unterziehen müssen, verbessern.
Prof. Gfeller und Prof. Villard werden modernste Immunpeptidomik-Daten, Algorithmen des maschinellen Lernens und klinische Daten nutzen, um ihren Prädiktor für die genetische Kompatibilität von Spender und Empfänger zu entwickeln. Dieses Modell soll aus früheren Transplantationsergebnissen lernen, was zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Vorhersagefähigkeit führen wird. Das Team möchte seine Ergebnisse mit aktuellem medizinischen Wissen verknüpfen. So soll ein robustes Instrument entwickelt werden, das direkt in der Klinik eingesetzt werden kann, um fundiertere Entscheidungen bei der Spenderauswahl treffen zu können.
Verletzungen als Treiber der Krankheitsprogression beim Basaliom
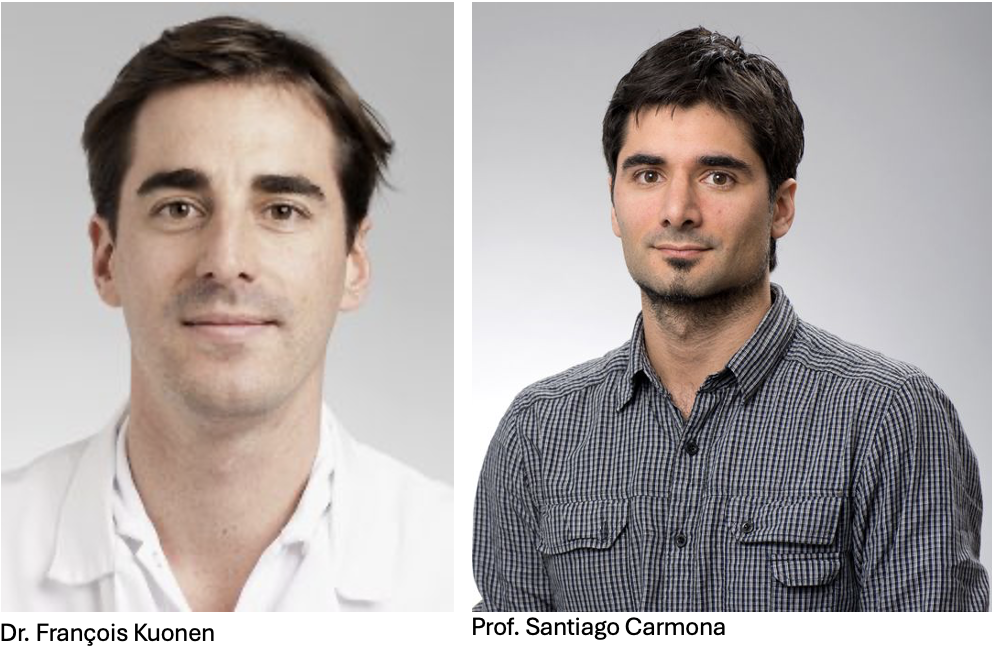
In diesem Projekt wird mit einem systembiologischen Ansatz untersucht, ob Verletzungen bei der chirurgischen Entfernung des Basalioms die Progression der Erkrankung vorantreiben. Ausserdem wird untersucht, welche Implikationen sich daraus für neue therapeutische Massnahmen ergeben.
Das Basaliom stellt die häufigste Krebsart beim Menschen dar. Während die meisten Basaliome chirurgisch entfernt werden können, erreichen einige dieser Tumoren ein fortgeschrittenes, invasives Stadium, für das wirksame Therapien noch fehlen. Wir stellen die Hypothese auf, dass Verletzungen eine Schlüsselrolle in der invasiven Progression des Basalioms spielen und dass die Entschlüsselung dieses Mechanismus zu verbesserten Therapien führen wird. Unsere Ziele umfassen i) die Charakterisierung der Mechanismen, mit denen Verletzungen die Basaliomprogression (in Bezug auf Krebszellplastizität, Umgestaltung der Tumormikroumgebung und Zell-Zell-Interaktionskreisläufe) vorantreiben; und ii) die Identifikation verwertbarer molekularer Ziele, mit denen die verletzungsinduzierte Basaliomprogression umgekehrt und Therapieresistenzen überwunden werden können. Zu diesem Zweck wird das multidisziplinäre Forschungsteam räumliches Einzelzell-Transkriptom-Profiling und eine ex vivo Kultur von aus Patienten gesammelten Tumorfragmenten mit der Entwicklung von rechnergestützten Methoden kombinieren.
Das Projekt hat das Potenzial, grundlegende, nicht nur beim Basaliom vorhandene Mechanismen, welche Verletzungen mit der Krebsprogression verbinden, aufzudecken und darüber hinaus den Krankheitsverlauf bei Patienten mit fortgeschrittenem Basaliom, bei denen Standardtherapien derzeit versagen, zu verbessern.
Verbesserung der Darmkrebsbehandlung zur Verhinderung von Metastasen
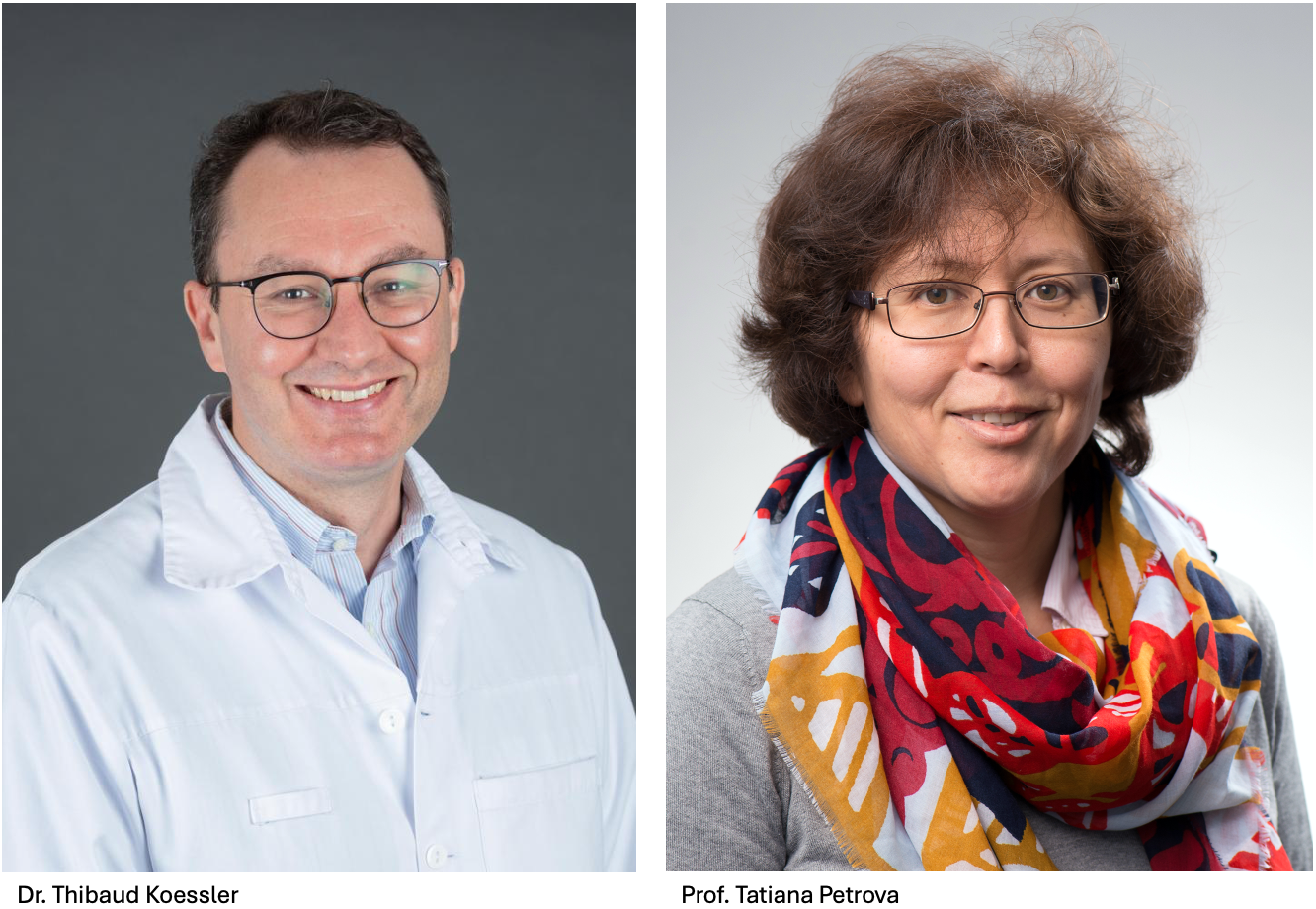
Das kolorektale Karzinom (KRK) ist weltweit eine der Hauptursachen für krebsbedingte Sterblichkeit, und Chemotherapie ist nach wie vor die gängige Behandlung für das KRK im Stadium II und III. Problematisch bei der Chemotherapie ist, dass sie nicht nur Krebszellen abtötet, sondern auch gesundes Gewebe im Darm und in der Leber angreift. Noch ist unbekannt, wie eine Chemotherapie die Physiologie und die Empfindlichkeit dieser Gewebe verändert. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass nach Beginn einer Chemotherapie bakterielle Metaboliten aus dem Darm freigesetzt werden. Diese Metaboliten sind in der Lage, Lebermetastasen zu verhindern, indem sie das Metastasenwachstum unterbinden und die immunvaskuläre Nische der Leber umprogrammieren.
In diesem TANDEM Projekt werden Prof. Petrova und Dr. Koessler zusammenarbeiten, um das therapeutische und diagnostische Potenzial dieser Erkenntnisse für KRK-Patienten zu untersuchen. Zu diesem Zweck werden sie eine Analyse der Metaboliten, die als Antwort auf die Chemotherapie ausgeschüttet werden, durchführen, die Lebermetastasen-Nische charakterisieren und die Auswirkung der Metaboliten auf Organoide untersuchen. Diese Organoide sind Miniaturversionen der Leber, die mithilfe von Patientengewebe in vitro gezüchtet werden.
Ziele sind insbesondere:
- Die Erstellung eines Profils der Metaboliten, die als Antwort auf die Chemotherapie in KRK-Patienten und relevanten Tiermodellen ausgeschüttet werden.
- Die Charakterisierung der Veränderungen in der Lebermetastasen-Nische als Antwort auf die Chemotherapie und Komponenten der Darmmikrobiota.
- Die Untersuchung der Wirkung, welche die ausgeschütteten Faktoren auf das Wachstum von aus Patienten abgeleiteten Organoiden und auf die Metastasenbildung in vivo haben.
Das Projekt soll Aufschluss darüber geben, wie die Reaktion von Organen auf die Chemotherapie die Behandlungsergebnisse direkt beeinflussen kann. Das translationale Ziel dieses Projektes besteht darin, den gegenwärtigen Mangel an Biomarkern, welche die Empfindlichkeit der Chemotherapie in der klinischen Praxis vorhersagen könnten, zu beheben. Letztendlich könnten somit auch diagnostische Instrumente und therapeutische Optionen verbessert werden.
Beurteilung der neoantigenspezifischen T-Zell-Antwort in der mit hyperthermischer, intrathorakaler Aerosol-Cisplatin-Druckchemotherapie (PITHAC) behandelten Pleurakarzinose
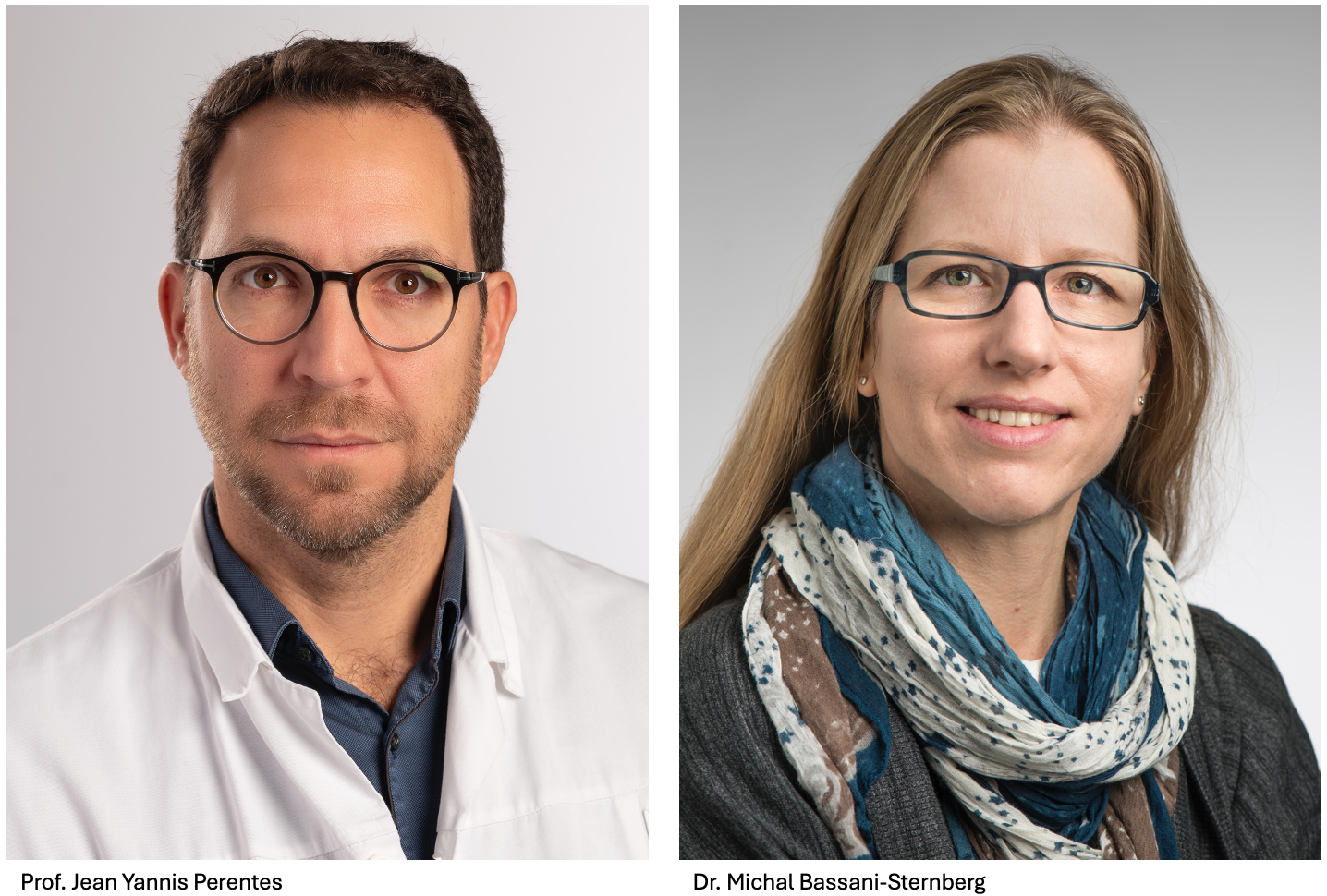
Die Pleurakarzinose tritt ausserhalb der Lungen auf, zwischen den Lungen und der Brustwand, in einem Hohlraum der eine Schmierflüssigkeit enthält, oder entlang des Brustfells, einer Membran, die die Lungen umgibt und die Brusthöhle auskleidet. Krebs in der sogenannten Pleurahöhle wird in der Regel von einer anderen Stelle des Körpers eingeschleppt, am häufigsten über Lungenkrebs. Möglich ist aber auch eine Ausbreitung ausgehend von der Brust, den Eierstöcken, der Bauchspeicheldrüse, dem Dickdarm oder anderen Körperteilen. Da Pleuratumoren fast immer metastatisch und schwer zu operieren sind, ist die Prognose schlecht. Nur einer von vier Patienten überlebt die ersten fünf Jahre nach der Diagnose. Glücklicherweise ist die Inzidenz tief: Diese Krankheit trifft einen von 2’000 Krebspatienten.
Ein neuartiger therapeutischer Ansatz für die Pleurakarzinose kombiniert lokalisierte, druckunterstützte Verabreichung von Medikamenten mit einer hitzeinduzierten Immunstimulation, die als PITHAC (pressurized intrapleural hyperthermic aerosol chemotherapy) bezeichnet wird. Es wird davon ausgegangen, dass PITHAC eine tumorspezifische Antwort auslöst. Die Wirksamkeit dieses Ansatzes in der Behandlung der Pleurakarzinose ist jedoch noch wenig erforscht.
Dieses Projekt vereint einen Kliniker mit Erfahrung in der Behandlung der Pleurakarzinose und eine Expertin auf dem Gebiet der biochemischen Proteinanalyse. Ziel ist es festzustellen, ob PITHAC neue Antigene in den Tumorzellen induziert, die wiederum eine neoantigenspezifische Reaktion im Immunsystem, insbesondere in den T-Zellen, auslösen. Mittels Charakterisierung der Antigenlandschaft in den Tumoren von Pleurakarzinose-Patienten wird es möglich sein zu ermitteln, ob die Anwendung von PITHAC auch die Induktion von schützenden neoantigenspezifischen T-Zell-Antworten bewirkt. Ist das der Fall, wäre es sinnvoll, PITHAC mit Immuntherapien zu kombinieren, um deren Wirksamkeit zu erhöhen.
Die Forschenden werden diese Analyse auf Patienten anwenden, die an einer Phase-1 klinischen Studie teilnehmen, die 2023 am CHUV gestartet ist. Sie dient der Untersuchung von Anwendbarkeit und Toxizität von PITHAC bei Pleurakarzinose-Patienten. Im Verlauf der Studie werden auch Blut- und Pleuraflüssigkeitsproben gesammelt (nach einer Operation und regelmässig, während eines Monates). Die TANDEM-Unterstützung wird die Analyse dieser Proben finanzieren.
Die Neuartigkeit dieses Projektes besteht in der Durchführung einer longitudinalen Antigenentdeckungsstudie, die Patienten vor und nach der Therapie vergleicht. Es ist zu hoffen, dass diese Untersuchungen den Einsatz von PITHAC in Kombination mit Immun-Checkpoint-Blockade-Inhibitoren begünstigen und die translationale Wirkung der Studie verstärken.

